Bestandsaufnahme
Section outline
-
Die Bestandsaufnahme kann sowohl in Vorbereitung als auch zu Beginn des Pädagogischen Tags durchgeführt werden. Sie dient dem Einstieg in die gemeinsame Arbeit. Mit diesen Ergebnissen können – beispielsweise im Plenum oder in Kleingruppen – konkrete Entwicklungsschwerpunkte abgeleitet sowie in einem nächsten Schritt hieraus Arbeitsfelder priorisiert werden. Das Festlegen konkreter Aspekte bzw. das Priorisieren von Arbeitsfeldern in Form von Meilensteinen (Zielperspektiven) soll dazu beitragen, den digitalisierungsbezogenen Schulentwicklungsprozess zu strukturieren.
A: "GuTe DigiSchulen NRW"
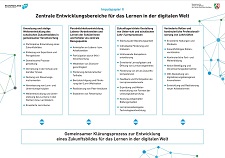
B: Impulspapier II
C: SELFIE
D: Integration digitaler Schlüsselkompetenzen in die Berufliche Bildung
-

A: "GuTe DigiSchulen NRW"
Eine Unterstützung bei der Bestandsaufnahme wird über Materialien des Forschungsprojekts „GuTe DigiSchulen NRW“ („Gelingensbedingungen und Transfer von erfolgreichen Digitalisierungsprozessen an Schulen in NRW“) der Technischen Universität Braunschweig ermöglicht. Ausgehend von den Dimensionen digitalisierungsbezogener Schulentwicklung bietet die Praxishandreichung konkrete Reflexionsfragen zu verschiedenen Entwicklungsbereichen, Gelingensbedingungen und Stolpersteine sowie weiterführende Informationen und Literaturhinweise. Die Schule kann in diesem Prozess von umfangreichen Erfahrungen der an dem Forschungsprojekt teilgenommenen Schulen und der wissenschaftlichen Auswertung profitieren und eigene Schul- und Unterrichtsentwicklungsperspektiven ableiten.Zu jedem Entwicklungsbereich bietet die Handreichung:
- Reflexionsfragen für Lehrkräfte
- Gelingensbedingungen für digitalisierungsbezogene Schul- und Unterrichtsentwicklung
- Hinweise auf mögliche Stolpersteine
- Weitere Informationen/Literatur/Links
Reflexionsfragen
Mittels Reflexionsfragen zu jedem Entwicklungsbereich kann ein IST-Stand der jeweiligen Schule Ausgangspunkt einer Auseinandersetzung mit Schul- und Unterrichtsentwicklung sein. Die Fragen können vorbereitend von Steuer- oder Schulentwicklungsgruppe, Fachschaften oder dem Gesamtkollegium genutzt werden oder am pädagogischen Tag selbst ein Werkzeug für eine Standortbestimmung sein.
Gelingensbedingungen
Orientierung im Arbeitsprozess geben die Gelingensbedingungen, die in der Handreichung zur Verfügung gestellt werden. Voraussetzungen und pädagogische Haltungen, die digitalisierungsbezogene Unterrichtsentwicklung befördern, können die Formulierung von Entwicklungszielen der Schule unterstützen.
Stolpersteine
Wertvoll für die Arbeit sind auch die für jeden Entwicklungsbereich beispielhaft benannten Stolpersteine. Hier können Schulen von den Erfahrungen anderer Schulen in Bezug auf digitalisierungsbezogene Entwicklungsprozesse profitieren und für die individuelle Schule passende Anregungen finden, Schwierigkeiten zu antizipieren.
Die Arbeit kann in arbeitsteiligen Gruppen zu den einzelnen Entwicklungsbereichen, die anschließend zusammengeführt werden. Eine andere Möglichkeit besteht auf Ebene der Fachkonferenzen, indem die Entwicklungsbereiche vor dem Hintergrund der schulinternen Curricula als Impulse für die Unterrichtsentwicklung genutzt werden.
Nach der Bestandsaufnahme können sich Bausteine aus den Bereichen "Festlegung von Entwicklungszielen" und "Maßnahmenplanung und Umsetzung" anschließen, um einen festgestellten Entwicklungsbedarf konkretisierend zu bearbeiten.

Links 
Praxishandreichung GuTe DigiSchulen NRW*
* Gerick, J., Eickelmann, B., Rau, M., Panten, B., Rothärmel, A. Gottschalk, T. (2023): Digitalisierungsbezogene Schulentwicklungsprozesse erfolgreich gestalten. Handreichung für die schulische Arbeit zu den Ergebnissen des Forschungsprojekts ‚GuTe DigiSchulen NRW‘. Braunschweig: Technische Universität Braunschweig.
-
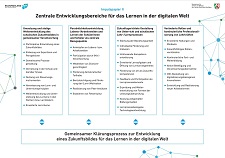
B: Impulspapier II
Mit dem „Impulspapier II – Zentrale Entwicklungsbereiche des Lernens in der digitalen Welt“ des Ministeriums für Schule und Bildung Nordrhein-Westfalen erhalten die Schulen in vier zentralen Entwicklungsbereichen konkrete Impulse und Leitideen für nächste mögliche Entwicklungsschritte bei der Gestaltung des Lernens in der digitalen Welt.
Die Schulen können am Pädagogischen Tag mit Hilfe des Impulspapier II eine Bestandsaufnahme zur digitalisierungsbezogenen Entwicklung der eigenen Schule durchführen. Auf Basis der Bestandsaufnahme werden schulische Zielperspektiven und Zukunftsbilder des Lernens in der digitalen Welt (weiter-)entwickelt und vereinbart. Methodisch bieten sich beispielsweise die Durchführung eines Worldcafés oder die Arbeit mit dem digitalen Evaluationstool von „Schultransform“ an, für welches eine kostenlose Registrierung der Schule notwendig ist. Für letzteres Tool hat die Bezirksregierung Arnsberg eine digitale Pinnwand erstellt, um einen Abgleich zwischen dem Impulspapier II und dem Evaluationstool von Schultransform zu ermöglichen.
Die Schulen in Nordrhein-Westfalen können in ihrer digitalisierungsbezogenen Schul- und Unterrichtsentwicklung Orientierung im Impulspapier II finden. Beispielhaft sind in dem unten abgelegten Dokument zu allen vier Säulen des Impulspapier II thematische Anregungen formuliert, die Schulen zur Bestimmung und Konkretisierung ihrer eigenen Zielsetzungen für den Pädagogischen Tag heranziehen können. Die Vorschläge stellen weder eine abschließende Liste noch eine verbindliche Setzung für die einzelne Schule dar.
Dateien 
Anregungen für Themen am Pädagogischen Tag zum Lehren und Lernen
in der digitalen Welt auf der Grundlage des Impulspapier II (Format: .pdf)

Links 
Impulspapier II 
Schultransform 
BR Arnsberg: Abgleich Impulspapier II und Schultransform
-

C: SELFIE - Tool der Europäischen Kommission
SELFIE („Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies“) ist ein kostenloses und einfach zu bedienendes Tool der Europäischen Kommission. Zur Nutzung ist eine kostenlose Registrierung der Schulen notwendig. Mit Hilfe von SELFIE können die Schulen eine Bestandsaufnahme zum Einsatz digitaler Technologien an der eigenen Schule durchführen. Hierzu werden verschiedene Gruppen (Schülerinnen und Schülern, Lehrkräfte, Schulleitung) zur Art und Weise des Technologieeinsatzes in der Schule anonym befragt. Nach Beendigung der Umfrage erhält die Schule einen SELFIE-Bericht (Ist-Stand mit den Stärken und Schwächen).
Im Rahmen des Pädagogischen Tags können die Schulen unter Berücksichtigung der verschiedenen Perspektiven die Kompetenzstände in Bezug auf das Lernen in der digitalen Welt auswerten. So können sie Entwicklungsziele erkennen und konkrete Aspekte der digitalisierungsbezogenen Schulentwicklung unter Berücksichtigung aller Blickrichtungen planen. Zur Sichtbarmachung schulischer Weiterentwicklungen über einen längeren Zeitraum kann die Bestandserhebung mit SELFIE wiederholend durchgeführt werden.Die Kompetenzen, welche mit der SELFIE-Befragung erhoben werden, entstammen dem DigCompEdu Kompetenzrahmen. In diesem Kompetenzrahmen werden 22 digitalisierungsbezogene Kompetenzen jeweils auf sechs Kompetenzstufen beschrieben. Die sechs Kompetenzstufen sind analog zu den Stufen des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER; A1, A2, B1, B2, C1, C2) gegliedert und haben zusätzlich angepasste Rollenbeschreibungen. SELFIE bietet neben "SELFIE für Schulen" als weiteres Tool "SELFIEforTEACHERS" an. Dieses Tool richtet sich an einzelne Lehrkräfte.

Links 
SELFIE für Schulen 
SELFIE für Lehrkräfte 
DigCompEdu Kompetenzrahmen
-

D: Integration digitaler Schlüsselkompetenzen in die Berufliche Bildung
Für die Berufskollegs eignet sich – ggf. ergänzend – die Handreichung zur Integration digitaler Schlüsselkompetenzen in die Berufliche Bildung, Ein Austausch über den Ist-Stand der Berücksichtigung der Förderung digitaler Schlüsselkompetenzen kann entweder im gesamten Kollegium oder auf der Ebene der Fachkonferenzen oder der Bildungsgänge erfolgen.Die Handreichung zur Integration digitaler Schlüsselkompetenzen in die Berufliche Bildung berücksichtigt drei Ebenen:
- Stärkung der Medienkompetenz, des Anwendungs-Know-hows und der informatischen Grundkenntnisse bei Lehrkräften an Berufskollegs mit Blick auf Bestandteile der Handlungskompetenz der Lernenden
- Berufsbezogene Anwendung innovativer digitaler Medien im Unterricht (beispielsweise im Rahmen von Informationsbeschaffung, Betriebskommunikation und Arbeitsorganisation)
- Fachbereichsspezifische unterrichtliche Umsetzung digitaler Entwicklungen in Arbeits- und Geschäftsprozessen
Darüber hinaus stehen exemplarische Lernsituationen für alle Fachbereiche mit expliziter Förderung digitaler Schlüsselkompetenzen als bearbeitbare Dokumente für die Bildungsgangarbeit sowie Unterrichtsentwicklung, -durchführung und -evaluation zum Download bereit.
Weitere Hinweise auch für die Bildungsgangarbeit und zur didaktischen Jahresplanung bietet die Broschüre "Didaktische Jahresplanung: Pragmatische Handreichung für die Fachklassen des dualen Systems" mit dem zugehörigen Einleger "Förderung digitaler Schlüsselkompetenzen".
Für die Reflexion des Ist-Standes der Integration digitaler Schlüsselkompetenzen unterstützt das Reflexionstool für Lernsituationen Lehrkräfte bei der Visualisierung des Grades der Förderung digitaler Schlüsselkompetenzen in einzelnen oder allen Lernsituationen eines Lernfeldes/einer Anforderungssituation. Abhängig von der geplanten Nutzung der Visualisierung (Unterrichtsentwicklung, Bildungsgangarbeit ...) stehen verschiedene Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung.
Die chancengerechte Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht gewinnt unter der Perspektive der Integration digitaler Schlüsselkompetenzen immer mehr an Bedeutung im unterrichtlichen Alltag. Die "Handreichung zur chancengerechten Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht im Berufskolleg" liefert vielfältige Informationen zur chancengerechten Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht im Berufskolleg und zur diesbezüglichen Planung, Durchführung und Reflexion. Darüber hinaus werden exemplarische Lernsituationen, weiterführende Literatur(-Links) und eine Auswahl von Tools und Methoden zum Lernen im Unterricht in den Berufskollegs veröffentlicht.
-
